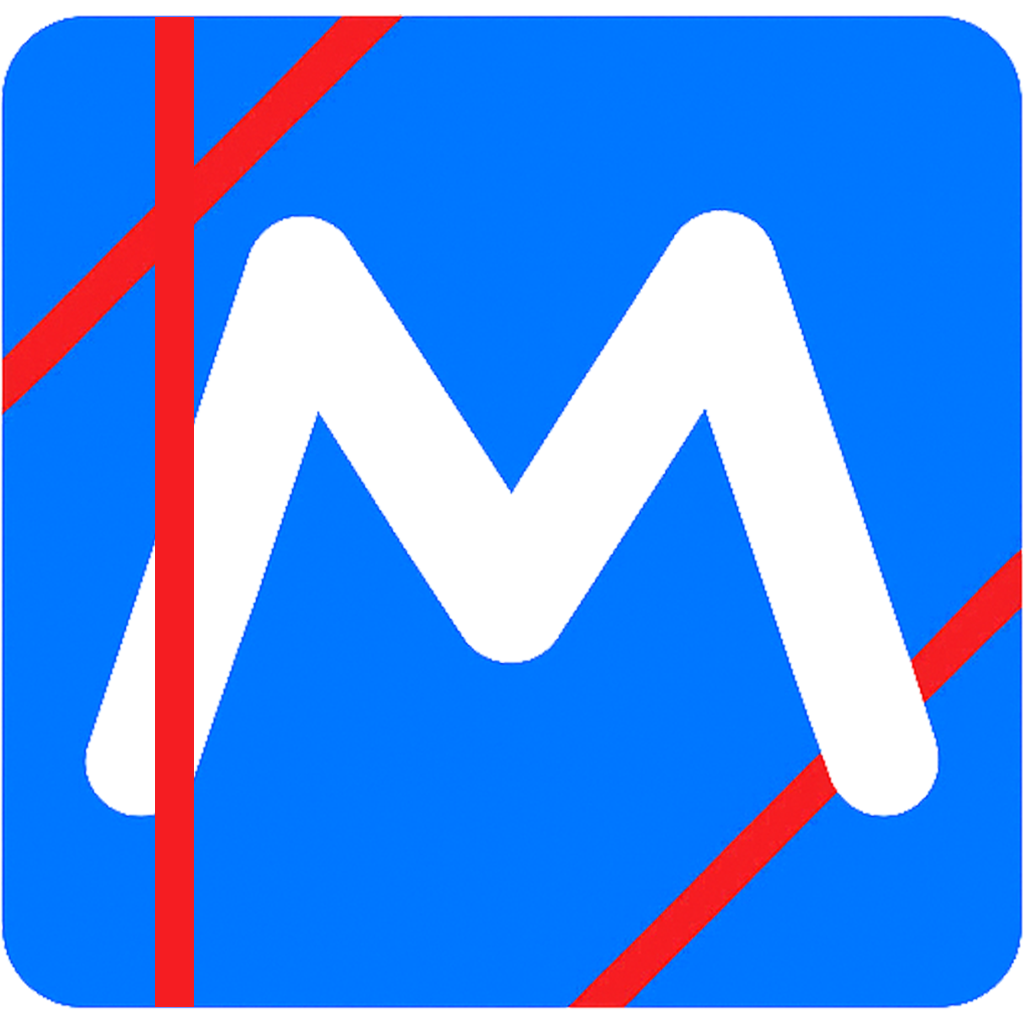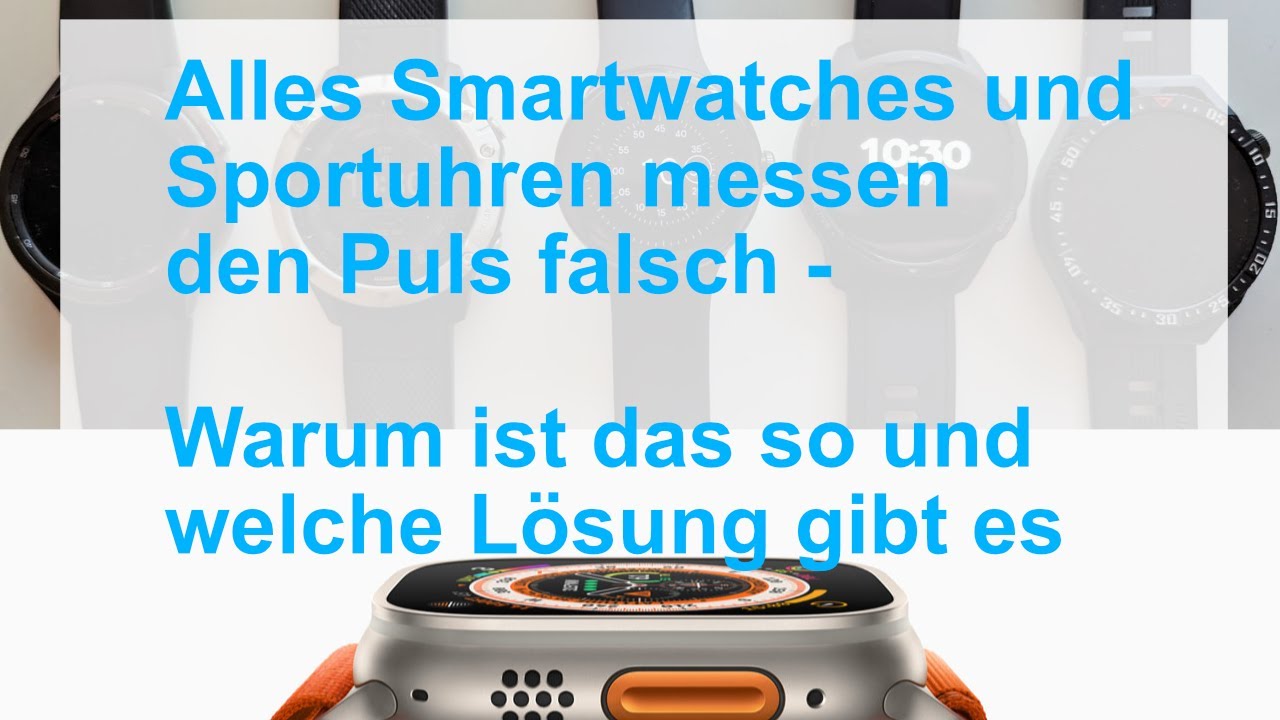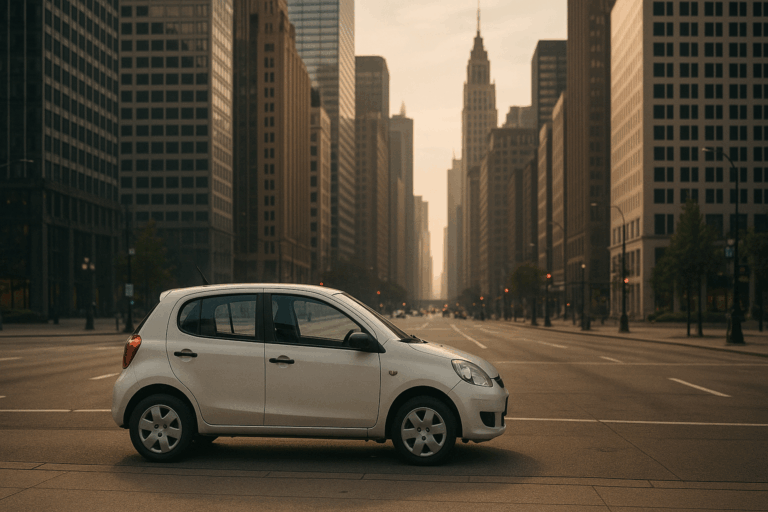Die Konservativen diskutieren derzeit ein mögliches Aufweichen des ab 2035 geltenden Verbrennerverbots. Sie erhoffen sich von einer Fortführung dieses Antriebskonzeptes positive Impulse für die deutsche Automobilindustrie. Im Zuge eines Paradigmenwechsels ist es jedoch oft herausfordernd, von konservativen Akteuren schnelle Lösungen zu erwarten. Im Rahmen dieser Diskussion wird deutlich, dass bei einigen Vertretern von CDU/CSU Fachkenntnisse im Automobilbereich nicht mehr so präsent sind wie früher.
Die deutsche Automobilindustrie steht vor einer historischen Entscheidung. Mit einer Produktion von 15 Millionen Fahrzeugen pro Jahr ist klar, dass die heimische Bevölkerung allein diese Menge nicht aufnehmen kann. Selbst wenn jedes deutsche Haushalt alle drei Jahre ein neues Auto kaufen würde.
Globale Abhängigkeiten und Absatzmärkte
Die USA könnten aufgrund der „America First“-Politik und hoher Zölle als Abnehmer wegfallen, während China wegen des „strategisches Ausbremsen von Verbrennern“ nur noch eingeschränkt deutsche Autos kauft.
Auch der britische Markt ist nach dem Brexit stark geschrumpft. Im Rust-Belt befinden sich viele Regionen wirtschaftlich an der Schwelle eines Entwicklungslandes und das Geld für einen Porsche wird in Zukunft immer weniger werden.
In Europa setzen Frankreich, Italien und andere Länder zunehmend auf ihre eigenen Hersteller. Peugeot, Citroën, Renault, Fiat und andere nationale Marken stärken ihre Märkte, wodurch deutsche Premiumhersteller weniger Spielraum haben.
Märkte in Indien, Afrika oder Südamerika können diese Lücke ebenfalls nicht füllen, da die Bevölkerung dort kaum die Kaufkraft für teure Fahrzeuge wie Porsche, BMW oder Mercedes hat – geschweige denn für Millionen Stückzahlen.
Während in Deutschland abseits des Verbrenners immer noch die unterschiedlichsten Motorenkonzepte wie PHEV, HEV oder MHEV diskutiert werden, machen andere Nationen bereits Nägel mit Köpfen.
Es wirkt manchmal, als würde man wie meine Tochter auf den Satz „Zimmer aufräumen“ eine endlose Diskussion beginnen, was alles zum Zimmer gehört und ob „aufräumen“ auch bedeutet, alles unter das Bett zu schieben. Wir führen Stellvertreterdiskussionen, weil wir die eigentliche Wahrheit und Dringlichkeit nicht sehen wollen, während die Konkurrenz längst handelt.
Es ist schier unglaublich, was uns alleine die FDP und Christian Lindner mit ihrem Wasserstoff-Blödsinn gekostet haben.
Der Erfolg der deutschen Automobilindustrie ist über Jahrzehnte durch Zuverlässigkeit, Präzision und herausragende Ingenieurskunst entstanden. Doch genau diese Stärken allein reichen heute nicht mehr aus.
Die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Bevölkerung weniger technikaffin und digital orientiert ist, während nahezu jedes moderne Smartphone aus China deutlich fortschrittlichere Softwaretechnik bietet, als sie in den meisten deutschen Autos verfügbar ist.
Deutschland muss daher seine traditionellen Stärken mit einer konsequenten digitalen Transformation verbinden. Die Industrie muss sich als Premium-E-Mobilitätsstandort positionieren, Batterien, Software, Ladeinfrastruktur und Fahrzeugarchitektur massiv verbessern und vernetzte, intelligente Funktionen bieten, die den globalen Standard nicht nur erreichen, sondern übertreffen.
Nur so kann Deutschland im High-End-Segment international wettbewerbsfähig bleiben und China im Bereich der Premium-Elektromobilität effektiv unter Druck setzen.
Historische Projektprobleme und Belastungen
Wir Deutschen hatten historisch oft Schwierigkeiten, große Projekte erfolgreich und termingerecht umzusetzen.
Ob moderne Prestigeprojekte wie der BER, die Elbphilharmonie oder Stuttgart 21 oder historische Bauwerke wie der Kölner Dom und Schloss Neuschwanstein – immer wieder zeigen sich Verzögerungen, Kostensteigerungen und Planungsschwächen.
Diese Neigung, komplexe Vorhaben zu verzetteln, spiegelt sich auch in der aktuellen Debatte um die Zukunft der Automobilindustrie wider, wo Diskussionen über alternative Antriebe oft zu lang, zu kompliziert und zu politisch aufgeladen geführt werden, während andere Nationen bereits konkrete Schritte umsetzen.
Die Folgen dieser Verzögerungen wären gravierend: massive Investitionsverluste, zunehmender Verlust von Arbeitsplätzen, Schwächung des Standorts Deutschland im globalen Wettbewerb und steigende Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Lieferketten.
Hinzu kämen politische und gesellschaftliche Spannungen, da steigende Kosten und langsame Fortschritte die Akzeptanz der Transformation untergraben könnten.
Wer zögert, riskiert nicht nur wirtschaftliche Nachteile, sondern auch den Verlust der Innovationsführerschaft und die Belastung ganzer Generationen.
Herausforderungen bei der Umsetzung
E-Autos sind derzeit vergleichsweise teuer, weil Batterien noch einen großen Teil der Fahrzeugkosten ausmachen und die Produktion in Europa höhere Standards, Löhne und regulatorische Anforderungen erfüllen muss.
Im Vergleich dazu hat ein Verbrenner über 200 bewegliche Teile, viele veraltete Technologien, die ständig Wartung oder Reparaturen erfordern. Ein scheinbar günstiger Verbrenner verursacht langfristig deutlich höhere Kosten. Elektromobilität basiert hingegen auf einem viel einfacheren, zuverlässigeren Konzept mit weniger beweglichen Teilen, geringerem Verschleiß und niedrigeren Wartungskosten.
Anders als in China, wo BYD Fahrzeuge wie den Seagull bereits für rund 8.000 Euro anbietet, können wir in Europa unter den heutigen Bedingungen kein vergleichbares Fahrzeug zu diesem Preis produzieren. Niedrigere Löhne, vereinfachte Standards, staatliche Förderung und kompakte Fahrzeugkonzepte ermöglichen diese Preise in Asien, während Europa durch hohe Standards, komplexe Lieferketten und teure Rohstoffe ausgebremst wird.
Deshalb bleibt der logische Weg für deutsche Hersteller, sich auf Premium-Elektrofahrzeuge zu konzentrieren.
Die überalterte Gesellschaft in Deutschland muss verstehen, dass „Premium“ für junge asiatische Käufer nicht in millimetergenauen Spaltmaßen liegt, sondern in der verwendeten Software, der Vernetzung, der Energieeffizienz und dem technologischen Gesamtkonzept.
Dringlichkeit im globalen Wettbewerb
Die Dringlichkeit wird auch von Branchenexperten betont. Jim Farley, CEO von Ford, beschreibt Chinas Fortschritte im Bereich Elektromobilität als „die demütigendste Erfahrung, die ich je gemacht habe“. In einem Interview beim Aspen Ideas Festival betonte er, dass chinesische Autos „weit überlegene Technologie“ bieten und die gesamte digitale Nutzererfahrung auf ein neues Niveau heben. Farley hob hervor, dass Unternehmen wie Xiaomi und Huawei in chinesischen Fahrzeugen integriert sind und eine nahtlose digitale Vernetzung ermöglichen.
Er warnte: „Wenn wir in diesem Bereich verlieren, haben wir keine Zukunft mehr.“ Farley bezeichnete China als „den 700-Pfund-Gorilla“ der E-Mobilitätsbranche und erklärte, dass US-Automobilhersteller wie Tesla, GM und Ford im Vergleich zu China weit zurückliegen. Er führte dies auf die hohe Innovationskraft und die erheblichen staatlichen Subventionen in China zurück, die es den dortigen Herstellern ermöglichen, fortschrittliche Technologien zu niedrigeren Kosten anzubieten.
Die Botschaft ist eindeutig – handeln ist nicht länger optional, sondern überlebenswichtig.
Fazit
Die deutschen Hersteller stehen vor einer klaren Wahl. Wer konsequent auf E-Mobilität setzt, sichert Technologieführerschaft, Arbeitsplätze und den Zugang zu wachsenden Premiumsegmenten weltweit. Wer den Kopf in den Sand steckt und auf Lobbyarbeit oder den Verbrenner hofft, wird überrollt.
Deutschlands Überleben in der globalen Automobilwelt hängt davon ab, mutig voranzugehen und die Realität zu akzeptieren.